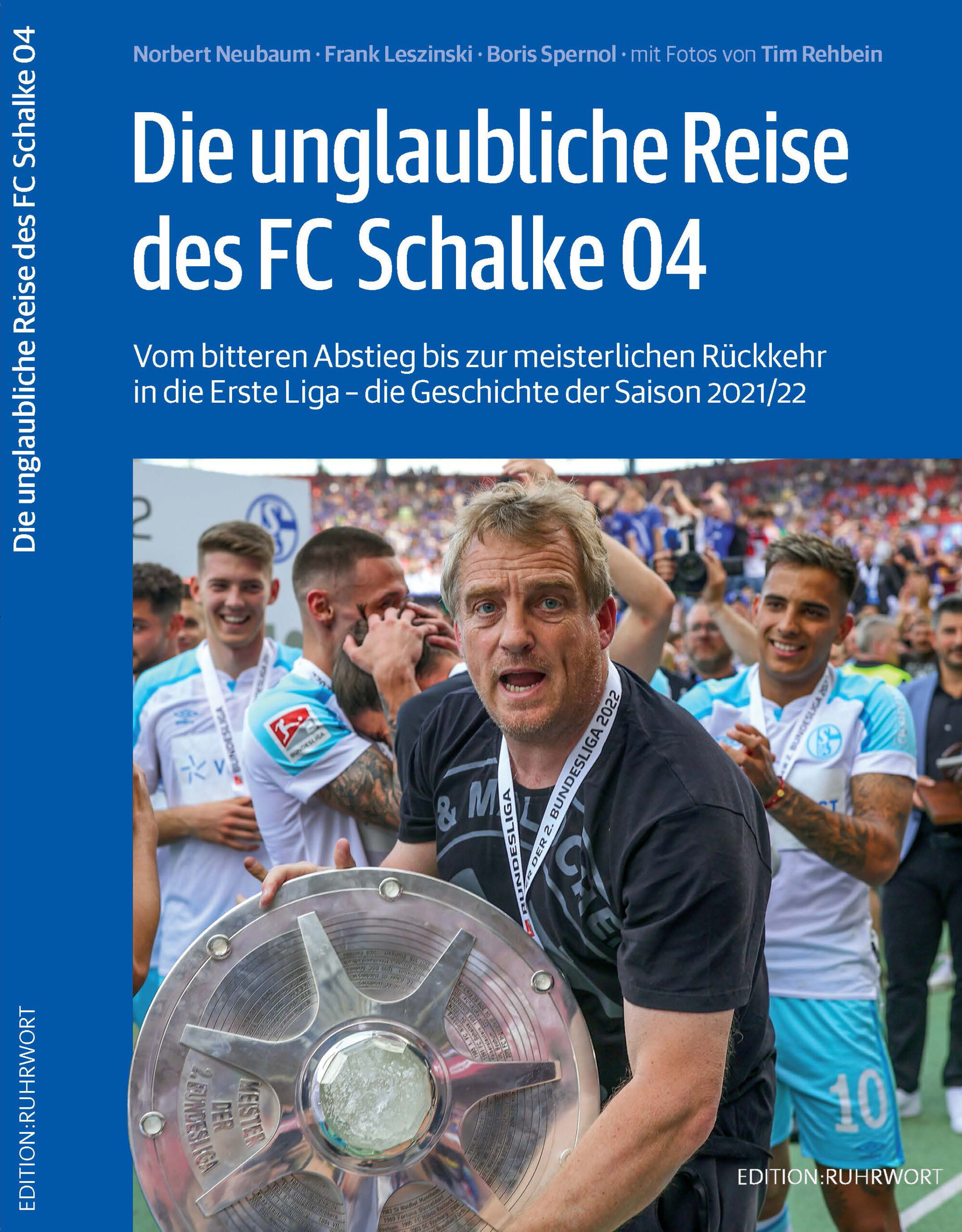Musiktheater im Revier: Generalintendant über Krieg, Corona, und Kultur

Ist seit 2008 Generalintendant des Musiktheaters im Revier: Michael Schulz. Foto: André Przybyl
Musiktheater im Revier: Generalintendant über Krieg, Corona, und Kultur
Sein erster Opernbesuch hat ihn verstört, dem Musiktheater ist Michael Schulz trotzdem treu geblieben. Der Generalintendant des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier über Krieg, Corona, und Kultur.
Herr Schulz, wie sind Sie zum Musiktheater gekommen?
Michael Schulz: Durch das Fernsehen. In meiner Kindheit liefen häufig klassische Musik und Opern im Abendprogramm. Meine Eltern haben regelmäßig „Erkennen Sie die Melodie?“ geschaut. Eigentlich musste ich um diese Uhrzeit bereits im Bett sein, aber ich habe immer heimlich an der Wohnzimmertür gelauscht. Einmal lief die „Diamanten-Arie“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach – die fand ich so toll, dass ich ins Wohnzimmer getreten bin, um mir das anzuhören.
Und dann sind Sie zum ersten Mal in die Oper gegangen…
Schulz: Mit zwölf habe ich „Die schweigsame Frau“ von Richard Strauss in Köln gesehen. Ich habe die Musik nicht verstanden, die Handlung auch nicht. Im Bühnenbild standen große Statuen von indigenen Fruchtbarkeitsgottheiten – mit überdimensionierten Genitalien. Nach der Vorstellung war ich außerordentlich verwirrt…
Der Theaterbesuch hat also nicht gehalten, was das Fernsehen versprochen hat?
Schulz: Doch, ich kann mich ja bis heute an die Aufführung erinnern. Die Hauptrolle sang ein Bass, dessen tiefe Töne mich beeindruckt haben. Das hat mich begeistert. Außerdem fand ich faszinierend, dass ich die Musik nicht zu fassen bekam. Meine zweite Aufführung war ganz klassisch „Die Zauberflöte“ – das war das nachhaltige Erlebnis überhaupt. Danach war ich infiziert.
Und sind beim Musiktheater geblieben…
Schulz: Zunächst habe ich mich für Theater im Allgemeinen interessiert – sei es Schauspiel, Tanz oder Oper. Das war mein Lebenselixier. Meine Obsession hat zu Auseinandersetzungen mit meinen Eltern geführt. Sie waren der Meinung, ich sollte lieber etwas für die Schule machen, anstatt ständig ins Theater zu rennen, da meine schulischen Leistungen sehr zu wünschen übrigließen.
Wie ist es dann weitergegangen?
Schulz: Zum einen hat ein Lehrer mein theatralisches Talent erkannt und mich dazu animiert, Theater zu spielen. Das fand ich ganz toll. Zum Schauspieler hat es später allerdings leider nicht gereicht. Zum anderen war es die katholische Kirche. Wir sind jeden Sonntag in die Messe gegangen. Zunächst dachte ich, ich müsste meinen Dienst in der Kirche suchen. Dann habe ich jedoch erkannt, dass mich dabei auch die „Show“, die perfekte Inszenierung interessiert hat. Später habe ich am Staatstheater Braunschweig in der Beleuchtung gearbeitet, um im Anschluss Musiktheaterregie in Hamburg zu studieren.
Seit 2008 sind Sie Generalintendant des Musiktheaters im Revier. Wie hat sich das MiR in dieser Zeit entwickelt?
Schulz: Das ist schwierig aus meiner Position zu beurteilen. Ich bin natürlich ein Teil des Motors, der das Musiktheater antreibt. Ich habe versucht, es zu einem Ort zu machen, an dem relevante Themen verhandelt werden. Es soll für die Stadtgesellschaft da sein. Das Musiktheater soll ein Betrieb sein, der nicht nur für das Gute, Schöne und Wahre steht, sondern sich auch für das interessiert, was außerhalb passiert.
Wie gelingt es Ihnen, diesen Anspruch umzusetzen?
Schulz: Vor einigen Jahren waren wir gezwungen, eine Million Euro einzusparen. Mit dem damaligen Geschäftsführer habe ich jedoch die Taktik verfolgt, nicht einzusparen, sondern das Geld zu erwirtschaften. Das ist uns nicht ganz, aber doch recht gut gelungen. Seinerzeit haben wir die Bandbreite unseres Programms und damit auch die Anforderungen an unseren Betrieb umgestellt und erweitert. Zuletzt haben wir unser Angebot dadurch bereichert, dass wir die Sparte Puppentheater gegründet haben. Was Inhalt und Ästhetik betrifft – das müssen andere beurteilen.
Gibt es eine Produktion, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Schulz: „Die Passagierin“ war für mich eine der Spitzenproduktionen, die wir gemacht haben. Das liegt bestimmt auch daran, dass die Autorin des Buches, das der Oper zugrunde liegt, uns besucht hat. Wir hatten ein umfassendes Begleitprogramm und das ganze Haus hat sich auf diesen Abend fokussiert. Aber mir fallen sofort 30 weitere Produktionen ein, die ebenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Besonders spannend und stark fand ich immer die Produktionen, in denen wir uns mit für die Oper untypischen und akut relevanten Themen auseinandergesetzt haben: „Charlotte Salomon“, „War Requiem“ oder „Mass“, aber auch „Klein Zaches, genannt Zinnober“ oder das Aufbrechen einer Repertoireoper wie „La forza del destino“.
Was kommt in Gelsenkirchen besonders gut an?
Schulz: Das ist unterschiedlich. Deshalb ist unser Spielplan so breit aufgestellt. Ich nehme nicht nur bekannte Opern, Musicals und Ballette ins Programm, sondern fordere das Publikum auch heraus. Was ankommt und was nicht, ist schwer vorherzusagen. Manche Produktionen, die ich für schwierig hielt, sind ein Renner geworden. Dagegen haben wir uns schon bei vermeintlichen Publikumsmagneten gefragt, warum der Zuspruch nicht so groß ist. Im Grunde funktioniert aber alles in Gelsenkirchen.
Seit über zwei Jahren schränkt die Corona-Pandemie den Kulturbetrieb deutlich ein. Am 2. April sind in Nordrhein-Westfalen alle Einschränkungen weggefallen. Bedeutete dieser Tag für Sie ein Aufatmen, weil es überstanden ist, oder eher ein Durchatmen, weil Sie dem Braten nicht trauen?
Schulz: Ich wundere mich schon, dass am 2. April Corona plötzlich vorbei gewesen sein soll – bei einer Inzidenz von 1.700. Zu Beginn der Pandemie wussten wir kaum etwas über das Virus, es gab auch keinen Impfstoff. Seinerzeit sind wir schon in Panik geraten, wenn die Inzidenz bei 20 lag. Heute haben wir uns an die Situation gewöhnt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie sich die Pandemie im Laufe des Jahres entwickeln wird. Viele Menschen sind noch sehr unsicher, sich mit vielen anderen in ein Theater zu setzen und dort drei oder vier Stunden gemeinsam zu verbringen. Bis auf eine Ausnahme habe ich zurzeit noch kein ausverkauftes Haus erlebt. Bis dahin wird es noch ein langer Weg sein. Für mich ist es also ein vorsichtiges Durchatmen, bei dem ich mich allerdings nicht erleichtert in den Sessel plumpsen lasse.
Drei- oder Zwei-G-Regel, geringe Auslastung – kann so das MiR kostendeckend arbeiten?
Schulz: Ohne staatliche Hilfen wäre es schon sehr schwierig, die Einnahme-Ausfälle zu kompensieren. Seit zwei oder drei Monaten sind wir außerdem damit beschäftigt, permanent Tests für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Die müssen angeschafft werden. Hinzu kommen Schutzkleidung, Masken und zusätzliches Personal, das Einlasskontrollen durchführt. Da kommt man wirtschaftlich an seine Grenzen.
Wiederholt haben Kulturschaffende in der Pandemie klare Öffnungsperspektiven von der Politik gefordert. Wie bewerten Sie den Umgang von Bund und Ländern mit der Kulturbranche?
Schulz: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann nicht allen vorwerfen, kurzsichtig agiert zu haben. Corona hat uns alle überrascht. Wirklich erschreckend war, dass die Kultur zu Beginn der Pandemie gar nicht vorgekommen ist. Das betrifft nicht nur uns als Theater, sondern alles, was mit Kultur und Kunst zu tun hat. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Zivilisation spielte plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Kultur tauchte in den Verordnungen – wenn überhaupt – hinter Bordellen und Spielcasinos auf. Doch dadurch, dass sich vor allem die freischaffenden Künstler massiv zu Wort gemeldet haben, scheint ein anderes Bewusstsein entstanden zu sein. Vielen ist klar geworden, dass ihnen ohne das Lebensmittel Kultur etwas fehlt. Das war ein positiver Nebeneffekt.
Hat Corona den Kulturbetrieb nachhaltig verändert?
Schulz: Nein, noch nicht. Zurzeit sind wir alle bestrebt, zu dem zurückzukehren, was wir vor drei Jahren gemacht haben. Aber wir haben viel gelernt. Mit unseren Mitteln haben wir versucht, digital zu arbeiten. Das wird sich in den nächsten Jahren bestimmt massiv entwickeln. Auch wir hoffen, daran arbeiten zu können. Doch wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, dann, dass das Digitale niemals das Analoge, das Erlebnis im Theater ersetzen kann.
Neben der Pandemie erschüttert nun der Krieg in der Ukraine die Welt. Sie haben selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus der Ukraine oder Russland kommen. Ist der Krieg ein Thema am Musiktheater?
Schulz: Es ist Tagesthema. Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Initiative ergriffen und helfen, wo sie können. Von einem anderen Theater habe ich erfahren, dass dort ein Mitarbeiter aus dem Baltikum russische Kollegen verbal attackiert hat – dahinter steckt natürlich Angst. Am Musiktheater im Revier sind keine Ressentiments gegenüber russischstämmigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu spüren. Unsere Haltung dem Krieg gegenüber ist klar: Wir haben am Haus unser Friedensbanner aufgehängt und beispielsweise ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine gegeben.
Am 12. Mai stellen Sie den Spielplan der kommenden Spielzeit am Musiktheater im Revier vor. Werden sich Krieg und Pandemie darin niederschlagen?
Schulz: Es wird keine Corona-Oper geben. Auch werden wir kein Musical über den Krieg machen. Ich plane einen Spielplan weit im Voraus, sodass ich nicht immer auf tagesaktuelle Ereignisse eingehen kann. In der ersten Woche des Krieges ist mir allerdings wieder „Der Kaiser von Atlantis“ eingefallen, das für mich das Stück der Stunde wäre. Es führt die Sinnlosigkeit des Krieges vor Augen. Der Tod weigert sich eines Tages, die Menschen und damit auch die Soldaten auf dem Schlachtfeld sterben zu lassen. Das führt zur Läuterung eines Diktators. Der Komponist Viktor Ullmann hat das Stück in einem Konzentrationslager geschrieben. Ich würde es gerne noch in den Spielplan aufnehmen, weiß aber nicht, ob mir das so kurzfristig gelingt.
Können Sie noch mehr von der kommenden Spielzeit verraten?
Schulz: Der gesamte Spielplan ist auf Machtstrukturen ausgerichtet, die wir reflektieren. Was bedeutet Macht? Was gibt mir Macht? Und wie kann Macht, die sich gegen die Gesellschaft, die Schöpfung wendet, gebrochen werden? Das sind Fragen, denen wir uns widmen wollen.